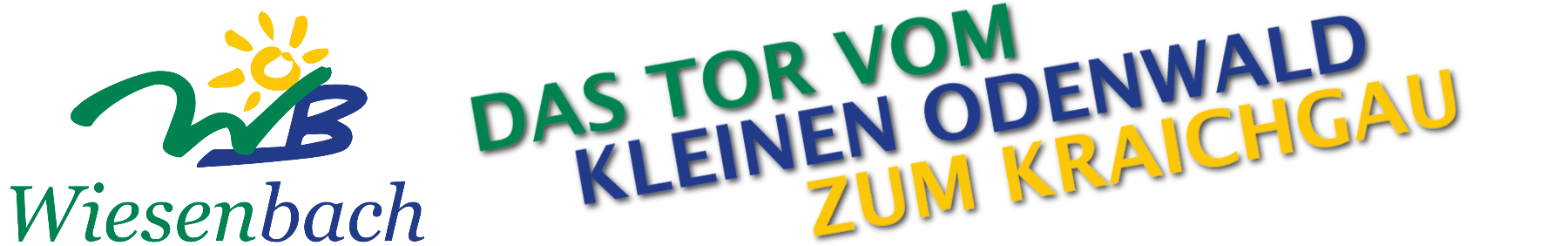Wohnen & Leben
Kommunale Wärmeplanung
Auf dieser Seite befasst sich die Gemeinde Wiesenbach zukünftig mit dem Thema "Kommunale Wärmeplanung".
Am 15.05.2024 wurde dieses Thema bei der Einwohnerversammlung genauer erläutert.
Erste Eindrücke können Sie der bei der Einwohnerversammlung präsentierten PowerPoint-Präsentation entnehmen.
Hier steht sie auch zum Download zur Verfügung.